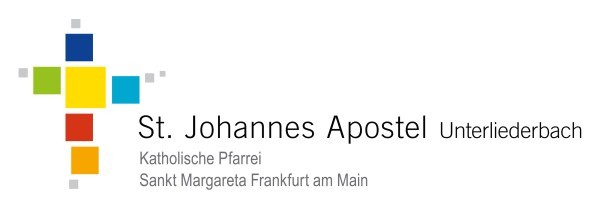Zeit des Nationalsozialismus und erste Nachkriegsjahre
Mitte der 1930er Jahre, lebten in Unterliederbach etwa 3.000 Katholiken, darunter viele in Arbeiter- und Angestelltenhaushalten. Die Reichstagswahlen 1933 brachten für Unterliederbach das folgende Ergebnis: Zentrum 12%, NSDAP 41%, Sozialdemokraten 19% und Kommunisten 17%. Pfarrer Friedrich Bertram (1934-1948) versuchte, den Gläubigen eine moralische Stütze zu geben und das kirchliche Leben so weit wie möglich unverändert fortzuführen. Er selbst wurde wegen „verleumderischer Racheakte“ zweimal zur Gestapo zitiert. Den Verhören folgten aber weder Verwarnungen noch Bestrafungen. Die Pfarrei wurde in ihrem Zusammenhalt durch den Nationalsozialismus nicht zerstört. Dennoch mussten sich die Katholiken den politisch bedingten Einschränkungen stellen: Verbot des Religionsunterrichts und Auflösung aller katholischen Vereine (1937), Schließung des Kindergartens (1941), Abgabe der großen Glocke zu Kriegszwecken (1942).
Während der Kriegszeit bestand ein Kriegsgefangenenlager für Franzosen im Saal der Gastwirtschaft „Nassauer Hof“, Liederbacherstr. 95. Nach Zeitzeugenaussagen führten Wächter die mit Fußketten Gefesselten in das I.G.-Farben-Werk zur Arbeit. Weitere ausländische Arbeitskräfte, darunter Polen und Niederländer, waren auf den Bauernhöfen und im Gartenbau tätig. Eigens für die französischen Kriegsgefangenen hielt Pfarrer Bertram von Weihnachten 1940 bis Mai 1941 in der Pfarrkirche Sonntagsgottesdienste mit bis zu dreißig Teilnehmern.
Die Zahl der Katholiken wuchs bis zum Jahr 1943 beständig an. Unterliederbach wurde am 2. Februar 1945 bombardiert. Das 1909 hinter der Kirche erbaute Schwesternhaus erlitt schwere Zerstörungen, ebenso das Kirchendach und alle Kirchenfenster. Im Kirchenraum lagerten zu dieser Zeit die Möbel der Anwohner.
 Die modernen Industrieanlagen der Farbwerke Hoechst (seit 1925 das IG-Farben-Werk Höchst) blieben im Krieg unzerstört und wurden von den Amerikanern 1945 eingenommen. Zu Wohnzwecken beschlagnahmten diese auch die zwischen 1900 und 1938 erbauten Wohnviertel im „Heimchen“, vertrieben die Bewohner und Eigner und zäunten das Gelände mit Stacheldraht ein. Das Wirtschaftswachstum in den 1950er Jahren ging, nachdem die Amerikaner das ehemalige IG-Farben-Werk und die Wohnhäuser wieder freigaben, auch an Unterliederbach nicht vorbei. Die mit einem Arbeitsverbot belegten Chemiker durften an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Große, neue Wohnsiedlungen entstanden (Abbildung der Loreleistraße und im Hintergrund des Städtischen Krankenhauses). Auch das kirchliche Leben verlief wieder in den aus Vorkriegszeiten gewohnten Bahnen. 1947 wurde der erste Pfarrausschuss gewählt.
Die modernen Industrieanlagen der Farbwerke Hoechst (seit 1925 das IG-Farben-Werk Höchst) blieben im Krieg unzerstört und wurden von den Amerikanern 1945 eingenommen. Zu Wohnzwecken beschlagnahmten diese auch die zwischen 1900 und 1938 erbauten Wohnviertel im „Heimchen“, vertrieben die Bewohner und Eigner und zäunten das Gelände mit Stacheldraht ein. Das Wirtschaftswachstum in den 1950er Jahren ging, nachdem die Amerikaner das ehemalige IG-Farben-Werk und die Wohnhäuser wieder freigaben, auch an Unterliederbach nicht vorbei. Die mit einem Arbeitsverbot belegten Chemiker durften an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Große, neue Wohnsiedlungen entstanden (Abbildung der Loreleistraße und im Hintergrund des Städtischen Krankenhauses). Auch das kirchliche Leben verlief wieder in den aus Vorkriegszeiten gewohnten Bahnen. 1947 wurde der erste Pfarrausschuss gewählt.
Für den PGR: Dr. Barbara Wieland
Bildnachweis: Karte: Hessisches Staatsarchiv Wiesbaden („Delineation einiger Gegendt von Höchst“. Karte der Wasserläufe und Überschwemmungsgebiete zwischen Höchst und Unterliederbach im Jahr 1723); Neubaugebiet Loreleistraße: http://www.hgv-unterliederbach.de/historische_bilder.html; Dorfkirche Unterliederbach: http://www.hgv-unterliederbach.de/ kalender_2007.html; Abbildungen des Kircheninnenraums: Bildarchiv der Pfarrei; Quellen: Pfarrarchiv Unterliederbach; Diözesanarchiv Limburg, Archiv der Hoechst AG/ HistoCom; Provinzarchiv der ADJC Dernbach. – Literatur: Festschriften der Pfarrei 1976, 1994, 1996 (dort weitere Lit.).